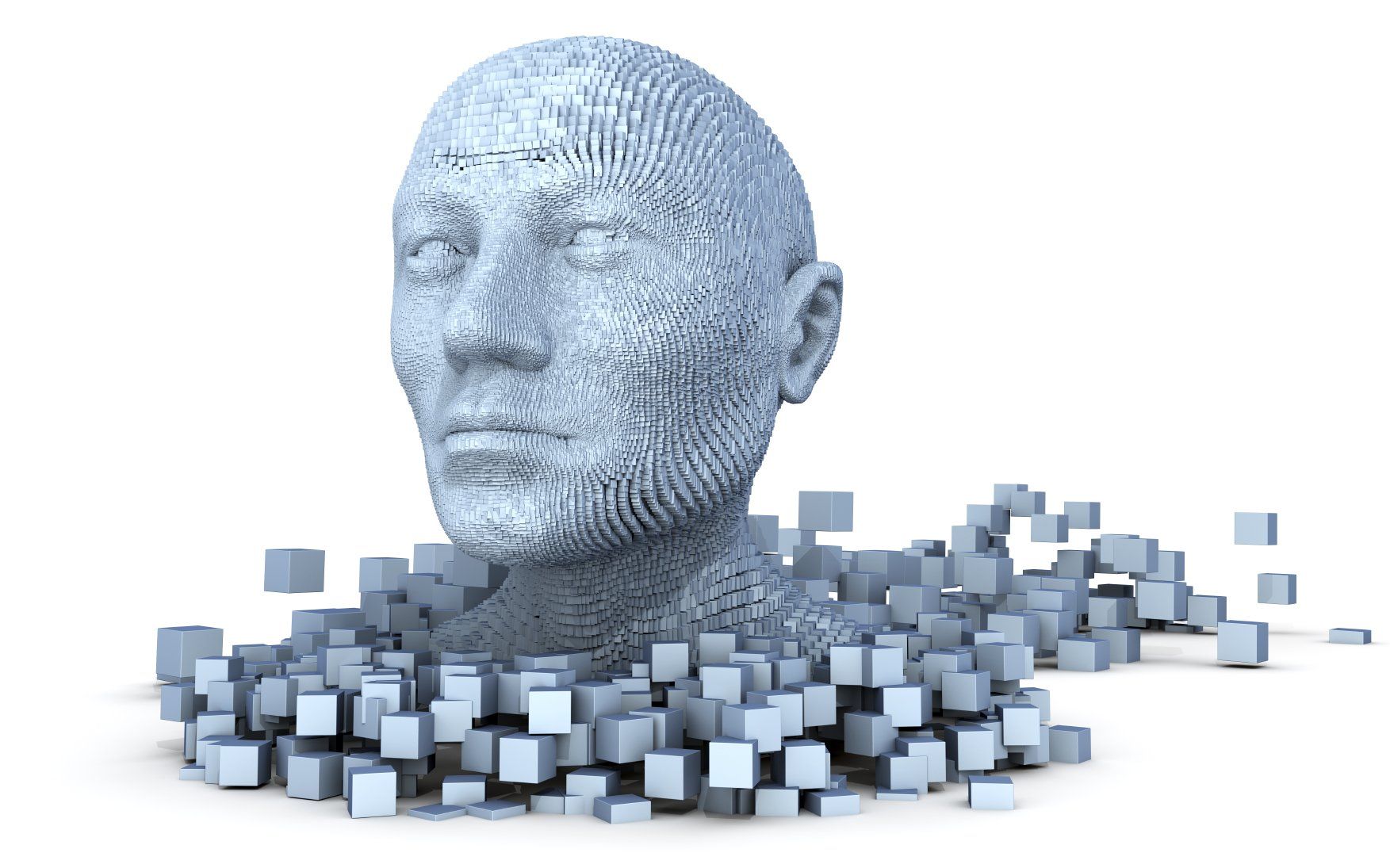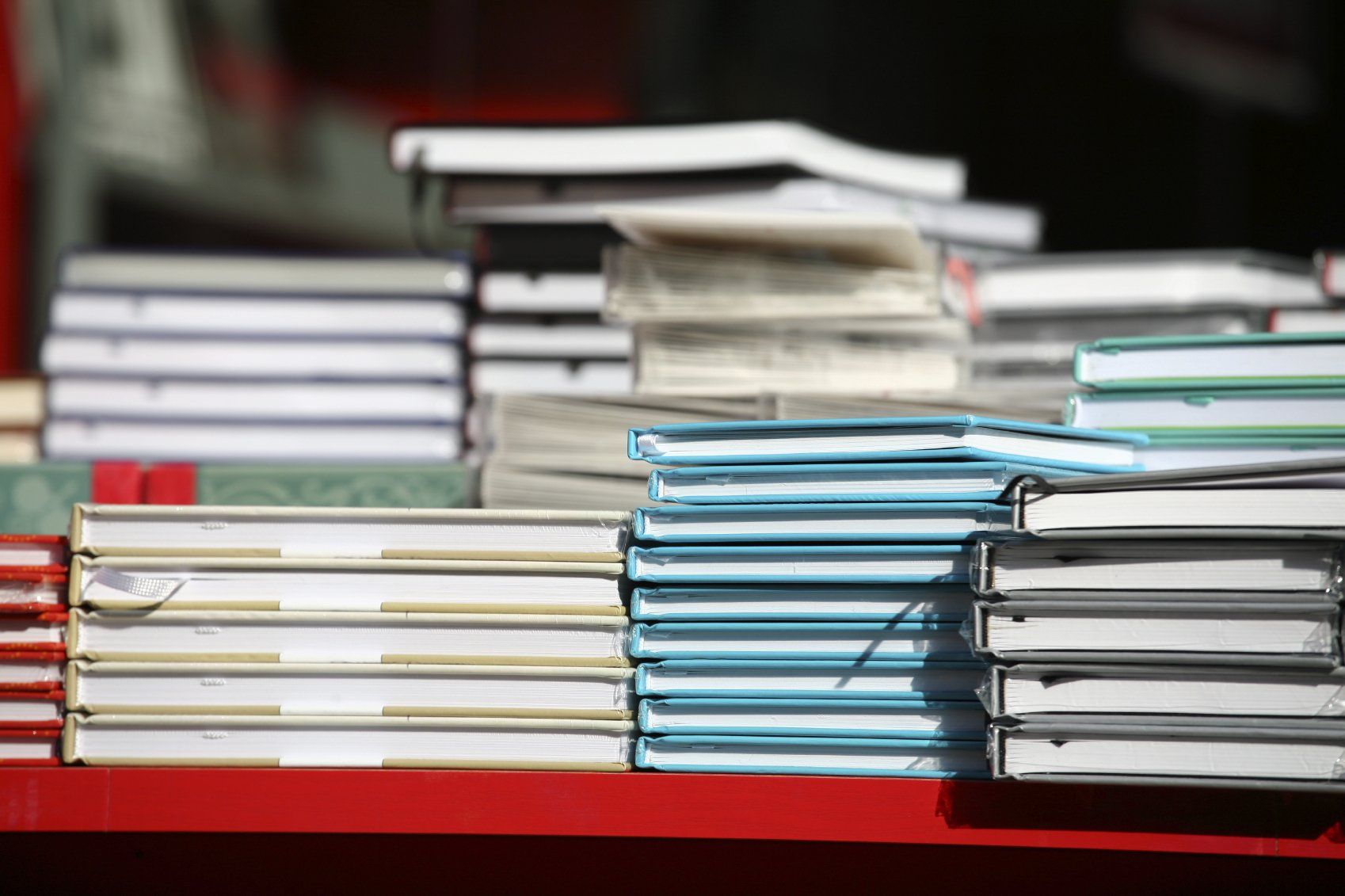KI-gestützte Telefonassistenten: Was Voicebots in Kommunen leisten können
Peter Baranec
Automatisierte Sprachsysteme entlasten Verwaltungen und verbessern den Bürgerservice – unter klaren Voraussetzungen

Wartezeiten am Bürgertelefon, überlastete Hotlines und steigender Aufwand für einfache Auskünfte: Viele Kommunen geraten im Alltag an ihre Grenzen. Ein Grund ist der zunehmende Fachkräftemangel, ein anderer die wachsende Zahl an Aufgaben. Eine technische Lösung gewinnt deshalb an Bedeutung: Voicebots – KI-gestützte Telefonassistenten, die einfache Anliegen automatisiert bearbeiten.
Digitale Entlastung für Standardanfragen
Voicebots sind digitale Systeme, die Gespräche mit Bürgern führen können – rund um die Uhr, in mehreren Sprachen und unabhängig von Öffnungszeiten. Ob Terminvereinbarungen, Auskünfte zu Gebühren oder Informationen zum Bearbeitungsstand: Was standardisierbar ist, lässt sich häufig automatisieren.
Voraussetzung ist die Anbindung an interne Systeme, etwa das Terminbuchungstool oder ein zentrales Informationssystem. Gelingt diese technische Integration, lassen sich Anfragen effizient abwickeln – und Mitarbeitende gewinnen Zeit für komplexere Anliegen.
Sprachverarbeitung durch KI
Moderne Voicebots nutzen künstliche Intelligenz (KI), um gesprochene Sprache zu verstehen. Sie analysieren Satzstruktur, Sprachtempo oder Formulierungen und erkennen die Absicht des Anrufers („Intent“). Mit jeder Nutzung verbessert sich der Bot – durch maschinelles Lernen und gezielte Nachjustierung.
In vielen Fällen werden regelbasierte Dialoge mit KI-Technologien kombiniert. So entsteht ein hybrider Ansatz, der sowohl bei Routinefragen als auch bei leicht abweichenden Formulierungen zuverlässig reagieren kann.
Anforderungen an den Betrieb
Für den erfolgreichen Einsatz braucht es mehr als nur Technologie:
Klare Zuständigkeit: Ein verantwortliches Team muss das System betreuen, Inhalte pflegen und den technischen Betrieb sicherstellen.
Datenschutz: Der Schutz sensibler Sprach- und Verbindungsdaten ist besonders in Kommunen essenziell. Lösungen mit europäischer Cloud-Infrastruktur und verschlüsselter Verarbeitung werden bevorzugt.
Systemintegration: Nur mit Zugriff auf aktuelle Daten aus Verwaltungssoftware und CRM-Systemen kann der Voicebot effektiv arbeiten.
Praxiserfahrungen aus Karlsruhe und Heidelberg
Während der Corona-Pandemie setzten Städte wie Karlsruhe auf Voicebots, um Anfragen zu Verordnungen oder Impfungen zu beantworten. Zwei Drittel der Anrufe wurden dort automatisiert bearbeitet – ein spürbarer Effekt. Auch nach der Pandemie kam die Technologie etwa im Einwohnermeldewesen weiter zum Einsatz.
Heidelberg verknüpfte seinen Voicebot gezielt mit bestehenden Systemen und beschränkte ihn auf die häufigsten Anliegen – eine Strategie, die laut Verwaltung für hohe Zufriedenheit sorgte.
Realistischer Einsatz – echter Mehrwert
Voicebots sind kein Ersatz für persönliche Gespräche – aber ein praktisches Werkzeug für den Alltag. Sie bieten die Chance, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Warteschleifen zu verkürzen und Mitarbeitende zu entlasten. Voraussetzung ist, dass Kommunen strategisch planen, ihre Prozesse kennen und Datenschutz ernst nehmen.
Wenn diese Grundlagen stimmen, können Voicebots ein wichtiger Baustein moderner Bürgerservices sein – und die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bevölkerung deutlich verbessern.